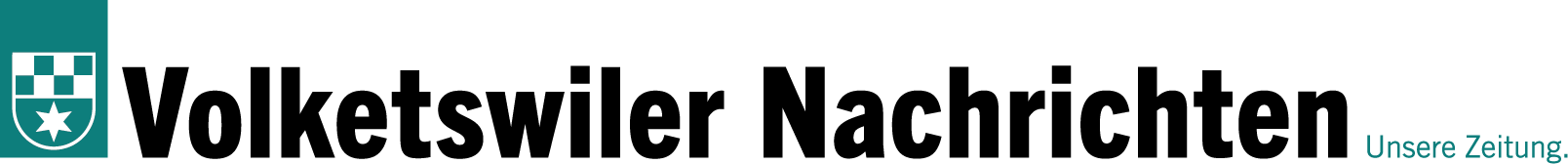So notiere ich stattdessen auf der Rückseite der Eintrittskarte, was ich gerade erlebe: Den dichten grünen Blättervorhang vor meinem Hotelfenster vermögen nur Vogelstimmen zu durchdringen; morgens und abends die wundersamsten Melodien und Ostinati rätselhaften Inhalts, am Sonntag vielleicht Halleluja, Halleluja.
Ebenso grün ist der Umschlag des Romans, den ich derweil verschlinge. Seinen Titel «Wassermusik» zu erläutern, will ich gerne dem Erzähler überlassen, T. C. Boyle, der mit dieser dicken Geschichte berühmt wurde. Der Roman umspinnt die Entdeckung des sagenhaften afrikanischen Flusses Niger durch den schottischen Forscher Mungo Park in einer monumentalen Erzählung des Scheiterns – hüben und drüben. Mungo Park überlebte seine erste Afrikareise (1795–1797), auf der er wenigstens mit dem Niger in Berührung kam, knapp und wurde bei seiner Rückkehr als Totgeglaubter entsprechend gefeiert. Seine zweite Reise (1805–1806) unternahm er nicht mehr als Einzelreisender, sondern in einem anfänglich fast fünfzigköpfigen, schwerbewaffneten Expeditionskorps. Mungo Park kam wie alle andern – im Roman mit einer einzigen Ausnahme – um.
Ob in Boyles Roman nun die Schilderung der Afrikareisen oder jene aus dem London zur Zeit König Georgs III. den grösseren Leserschrecken erzeugt, lasse ich gerne offen. Erschütternd ist ohne Zweifel, dass es dem Abenteurer nicht gelingt, seine Ehefrau von der Notwendigkeit seiner Reise zu überzeugen, geschweige denn auf sie zu hören und auf die zweite Reise zu verzichten. Wie alle war sie angesichts der Dauer der ersten Reise davon ausgegangen, ihr Mann sei irgendwo in Afrika gestorben. Sie wollte ihn nicht nochmals verlieren. Als mutiger Entdecker, aber feiger Ehemann blieb ihm nichts anderes übrig, als sich von seiner Gattin heimlich, unter Vorgabe eines harmlosen Reiseziels, quasi davonzuschleichen. Ein ehrliches Wort und ein aufmerksames Ohr zur rechten Zeit – und beider Leben wären anders verlaufen.
Erschüttert hat mich auch der Umstand, dass die erste Reise, bei der sich Mungo Park als sprachunkundiger Alleinreisender zwangsläufig andern Menschen anvertrauen musste, erfolgreich war, die zweite aber, auf der er mit Gewalt diesen geheimnisvollen Fluss erkunden wollte, nicht. Auf der ersten Reise, nackt und hilflos, gelang es ihm dank dem Rat eines europäisch gebildeten Afrikaners, sich Einheimischen gegenüber erkenntlich zu zeigen mit improvisiert beschrifteten Zettelchen: Segenssprüchen, Gedichtzeilen. Glasperlen oder Muscheln hatte er ja keine mehr als Zahlungsmittel. Sein Begleiter lehrte ihn: «Unterschätzen Sie nie die Kraft des geschriebenen Worts.»
So ein Satz freut mich doch als Vertreter einer Buchreligion. Allerdings: Auch das gesprochene Wort, zum Beispiel das seiner Gattin, hätte Kraft gehabt, wenn er ihm nicht aus dem Weg gegangen wäre.
Ach, wieso wissen wir immer alles besser?
Zeno Cavigelli, katholischer Seelsorger