Als Privatperson werde ich Ihnen, den mündigen Stimmbürgern, hier keine Entscheidungsempfehlung aufschwatzen. Da ich Ihre persönliche Situation zuwenig kenne und beurteilen kann, steht mir das auch gar nicht zu. Hätte ich von Ihnen ein Beratungs- oder Stellvertretungs-Mandat gemäss meinem Vorschlag für eine bessere Demokratie (Stakeholder- oder Betroffenen-Demokratie – siehe dazu separate Information) erhalten und angenommen, dann allerdings wäre es meine Aufgabe und Pflicht, mich mit Ihrer Situation auseinanderzusetzen und Ihnen meine Empfehlung einer für Ihre Situation bestmöglichen Entscheidung nahe zu legen. Einen Rat aber bekommen Sie nun trotzdem von mir: Versuchen Sie herauszufinden, was für Sie aus Ihrer persönlichen oder familiären Sicht das Beste wäre, bei jeder dieser zur Entscheidung vorgelegten Fragen und scheuen Sie sich nicht, diese egoistische Ansicht mit ihrem Stimmzettel zu vertreten (und entsprechende Forderungen zu stellen) - das ist Ihr gutes demokratisches Recht. Denn wenn jeder nach diesem Prinzip abstimmt, dann werden die Interessen einer Mehrheit sich durchsetzen – und das ist doch genau der Sinn einer demokratischen Entscheidungsfindung. Damit aber auch legitime Minderheiten-Interessen nicht einfach ohne gebührende Berücksichtigung majorisiert werden, ist bei der Stakeholder-Demokratie eine Würdigung solcher Interesse durch Fuzzy Logic (unscharfe Entscheidung) und der Möglichkeit einer schrittweisen Annäherung (sukzessive Approximation) an die "für alle Betroffenen bestmöglich akzeptable" Lösung ausdrücklich vorgesehen. Mit meinem Vorschlag der Stakeholder-Demokratie möchte ich ausserdem jedem Stimmbürger eine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit verschaffen, persönliche Hilfe und Unterstützung von einem Fachmann ("Politikanwalt") bei der Findung und Ausübung der für ihn bestmöglichen Entscheidung zu erhalten (selbstverständlich Aufwand-entschädigt und nicht etwa frei Haus), genau so, wie er sich in Rechtsfragen ja auch von einem Fachmann (Rechtsanwalt) beraten und vertreten lassen kann und dadurch in einem Rechtskonflikt (meistens) besser fährt.
Werner Klee, Kindhausen
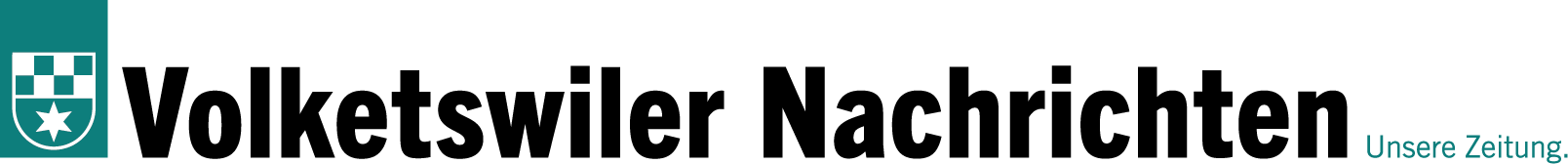

Kommentare (2)
w.klee@2wire.ch
am 31.01.2020Bessere Entscheidungsrechte der Bürger.
Grundsatz:
Jedes Mitglied einer Gemeinschaft hat ein Recht auf bestmögliche Vertretung seiner Interessen in dieser Gemeinschaft mit genau einer Stimme (der eigenen) bei allen Entscheidung, welche das Mitglied selbst und die Gemeinschaft betreffen.
Für politische Gemeinschaften (z.B. Staaten) gilt daher:
Jeder Bürger hat das Recht auf bestmögliche Vertretung seiner Interessen durch ein Mitentscheidungsrecht mit genau
einer einer Stimme (zum Beispiel seiner eigenen) bei allen „staatlichen Entscheiden“ (welche durch staatliche Instanzen im Namen des Volkes getroffen werden), von denen er betroffen ist.
Dieses Mitentscheidungsrecht nimmt der Bürger wahr bei staatlichen Entscheiden – mittels eigener Stimme bei Sach-Abstimmungen sowie fakultativem oder fallweise obligatorischem Referendums-Recht (in der heutigen direkten Demokratie), wenn Entscheidungen getroffen worden sind durch die Legislative (Parlamente) bei der Gesetzgebung
– mittels Einsprache, wenn Entscheidungen getroffen worden sind durch die Exekutive (Regierung und Behörden) – mittels Rekurs-Recht bei Entscheiden der Judikative (Richter).
Dabei soll er neu ausdrücklich das Recht haben, zwecks besserer Interessen-Wahrnehmung sich von einem Fachmann vertreten und dadurch unterstützen zu lassen. Das Konzept der getrennten drei Staatsgewalten zwecks breiter Verteilung der Staatsgewalt ist durch die gegenseitige Kontrolle dieser staatsmonopolistischen Gewalten unter Ausschluss einer demokratischen Kontrolle durch die Bürger unbefriedigend. Daher ist eine Ergänzung durch eine übergeordnete Staatsgewalt (die als Resolutive bezeichnet wird) notwendig, welche im Auftrag aller Bürger alle letztendlich gültigen Entscheidungen treffen kann. Mitglieder dieser Resolutiven (als Polit-Anwälte oder als Rechts-Anwälte bezeichnet) werden persönlich vom Bürger mandatiert, wobei dieses Mandat rechtlich als Auftrag zu betrachten und daher jederzeit aufkündbar ist. Die Anwälte informieren ihre Mandanten über anstehende politische beziehungsweise rechtliche Entscheidungen, teilen ihm die nach ihrer Meinung für den Mandanten (!) bestmögliche Entscheidung mit und stimmen dann ab in seinem Auftrag und Namen.
Selbstverständlich steht es dem Bürger frei, vom Anwalt entgegen der anwältlichen Empfehlung eine andere Stimme in seinem Namen zu verlangen. Er kann auch entscheiden, generell oder fallweise auf eine Anwaltsmandatierung zu verzichten und sein Stimmrecht selber wahrzunehmen. Der Bürger, der sein Entscheidungsrecht selber ausübt (also selber „stimmen geht“), ist dann ebenfalls Teil der Resolutiven – denn er hat damit das Mandat zur Vertretung der politischen bzw. rechtlichen Interessen sich selber übertragen und ist sein eigener Polit- bzw. Rechts-Anwalt.
Umsetzung:
– Bei allen staatlichen Entscheiden ist die Resolutive die höchste und letzte Entscheidungsinstanz.
– Den bereits bestehenden Staatsgewalten wird die Resolutive übergeordnet.
– Das Stellvertretungsverbot bei Abstimmungen und Wahlen ist zu ersetzen durch eine geeignetere Bestimmung, welche Stellvertretung im Interesse des Bürgers zulässt und trotzdem Missbräuche verhindert durch Bedingungen zur Zulassung als Stell-Vertreter (bei der Entscheidungsfindung) mittels Kompetenz-Nachweis sowie Anwaltskammer.
Erläuterung:
In der repräsentativen Demokratie werden bei Entscheidungen die Interessen eines einzelnen Bürgers vertreten (oder eben leider nicht vertreten) durch eine von einer Mehrheit, aber möglicherweise nicht vom betroffenen Bürger selber gewählten Person. Die repräsentative Demokratie verfehlt daher das Ziel, dass jeder Bürger die eigenen Interessen bei allen ihn betreffenden Entscheidungen selber mit der eigenen Stimme vertreten kann oder sich zumindest durch einen von ihm selber bestimmten Mandatsträger vertreten zu lassen. Demgegenüber ist die direkte Demokratie geeignet, diese vom Bürger als gerecht empfundene Mitentscheidungs-Kompetenz grundsätzlich zu ermöglichen. Eine echte und nachhaltige Interessen-Wahrnehmung setzt jedoch voraus, dass der Bürger zur Wahrnehmung seiner legitimen Interessen die für ihn bestmögliche Entscheidung trifft, was aufgrund der (zum Teil in eigennütziger Absicht von Politikern geheim gehaltenen oder „angepassten“) Informationen sowie möglicherweise mangelndem Sachwissen erschwert wird. Hier verhilft der persönlich mandatierte Anwalt dem Bürger zu einer besseren Interessenvertretung, so wie ein Rechtsanwalt in Rechtsfragen meistens eine bessere Interessenvertretung für den vertretenen Bürger erzielt.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Dauer von Funktion und Mandat : Parlamentarier, Exekutiv-Mitglieder sowie Richter üben ihre Funktion über eine längere Frist (meistens zumindest 3-4 Jahre) aus, was im Sinne der Kontinuität dieser Funktion durchaus sinnvoll ist, auch dann, wenn ein Teil der Bürger punktuell mit deren Funktions-Ausübung nicht zufrieden ist. Hingegen kann der Bürger seinem Polit- oder Rechts-Anwalt bei Unzufriedenheit mit den Konsequenzen aus dessen Empfehlung oder Entscheidungs-Vertretung das Entscheidungs-Mandat jederzeit entziehen.
Das vorgeschlagene Konzept verspricht eine erhebliche Verbesserung der Stimm- und Wahlbeteiligung sowie des Vertrauens in die Politik und den Staat : es beinhaltet den wertvollen Ansatz der deliberativen Demokratie, in welcher gesellschaftspolitische Entscheidungen durch sachbezogene öffentliche Diskussion gefördert werden.
w.klee@2wire.ch
am 02.02.20201. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, in gesellschaftspolitischen Entscheidungen am Entscheidungsprozess in geeigneter Form beteiligt zu werden, wenn sie von dieser Entscheidung selber betroffen sind.
2. Egoismus ist nicht à priori eine ausschliesslich negative Eigenschaft eines Menschen: da in jedem Menschen (genau genommen in jedem Lebewesen) auch ein egoistischer Kern steckt (oft allerdings unbewusst), ist es sinnvoller, diese egoistische Grundhaltung bei den Anderen und bei sich selber zu akzeptieren und sie bewusst zu kontrollieren versuchen, als diese Anderen als Egoisten einfach zu verurteilen. Dieser Egoismus kann erklärt und besser akzeptiert werden, wenn er verstanden wird als Konsequenz aus der Maslow‘schen Bedürfnis- und Motivationstheorie: die Befriedigung der beiden stärksten Bedürfnisse (Existenzielle Bedürfnisse und Sicherung) haben uns nicht nur die Fähigkeiten für ein egozentrisches Verhalten antrainiert (damit wir besser überleben können), sondern auch eine unbewusste und daher automatische Bevorzugung eines solchen Verhaltens bewirkt.
3. Das Lernspiel TUN (Teilen und Nehmen) und die daraus abgeleitete Anwendung der Spieltheorie TOPP (Theory of Partitioning and Participating) zeigen, dass eine Entscheidung eines Einzelnen oder auch einer zusammengehörigen Gruppe, in welcher jeder Entscheidungsträger die Bedürfnisse aller anderen Entscheidungsträger kennt (weil sie kommuniziert werden) und bewusst angemessen berücksichtigt, höheren Nutzen erbringt für die gesamte von der Entscheidung betroffenen Gemeinschaft(en) und sogar auch für jedes einzelne Mitglied dieser Gemeinschaft.
Sofern diese Erkenntnis auch angewandt (gelebt) wird, ist dies Legitimation der Mitentscheidungskompetenz für jedes einzelne Individuum mit seinen individuellen Bedürfnisse und Ansprüche in einer Gemeinschaft.
DURCH (3) SOLL DER NATÜRLICHE EGOISMUS (2) JEDES MENSCHEN (eigentlich jedes Lebewesens) HINTERFRAGT UND RELATIVIERT WERDEN, WEIL DIE INTELLIGENZ DES HOMO SAPIENS DIESEN BEFÄHIGT, ZU ERKENNEN, IN WELCHEN SITUATIONEN EINE BERÜCKSICHTIGUNG DER GEMEINWOHL-INTERESSEN FÜR ALLE BETROFFENEN BESSERE ERGEBNISSE ERBRINGT ALS EINE AUF NUR EGOISTISCHEN VORTEIL BEDACHTE ENTSCHEIDUNG.
4. Angemessene Berücksichtigung der Bedürfnisse von Minderheiten durch Fuzzy Logic bei demokratischen Entscheidungen („Verfeinerung“ der Entscheidung je nach Anteil Gegenstimmen)
5. Sukzessive Approximation bei demokratischen Entscheidungen.
(Verfeinerte Vorlagen auf Grund von Minderheiten-Bedürfnissen sowie Praxiserfahrungen bei der Umsetzung der Abstimmung/Entscheidung, weil vielleicht die Frage zu wenig Problem- und Zielorientiert war).
Die Schwarz/Weiss-Lösung einer ersten demokratischen Entscheidung ist in der Regel nicht der Weisheit letzter Schluss einer bestmöglichen politischen Lösung !