Für Medien (wie auch für Private) gilt grundsätzlich ein Recht auf freie Meinungsäusserung, und zum Schutz von Persönlichkeitsrechten wird diese Freiheit richtigerweise eingeschränkt durch entsprechende Regeln und Usanzen. Sinnvollerweise liegt die graphische Gestaltung der Präsentation von Informationen in den Händen von Redaktionen, die bei ihrer Erwägung nicht nur inhaltliche, sondern auch wirtschaftliche und technische Kriterien berücksichtigen müssen.
Nun stelle ich bei den gedruckten Medien gerade in Zeiten von Wahlen eine Häufung von (vermutlich meistens ungewollten) suggestiven "Nebenwirkungen" fest, von denen nun auch die beiden Volkertswiler Informationsmedien (die offiziellen Volketswiler Nachrichten sowie der Volketswiler) betroffen sind : In den VoNa wurde kürzlich ein Leserbrief eines Kirchenvertreter zum Thema des Missbrauchs von christlichen Werten aus politischen Motiven garniert mit dem Bild einer kandidierenden Politikerin auf dem Wahlplakat ihrer Partei. Was eigentlich nur zur Veranschaulichung gedacht war, hat die Politikerin empfunden als eine an sie adressierte persönliche Kritik, dass sie christliche Werte zu politischen Zwecken missbrauche, und dementsprechend heftig hat sie diesen Vorwurf zurückgewiesen.
Auch ich selber (und wohl noch etliche Leser) haben daher das Thema "Missbrauch christlicher Werte zu politischen Zwecken" mit der betroffenen Partei und Person zunächst automatisch assoziiert. Leser, die sich dieser falschen Assoziation bewusst waren, werden sie auch hinterfragt haben. Viel wirksamer (und in diesem Fall schädlicher) jedoch ist eine solche Assoziation, wenn sie im Unbewussten verbleibt und dort Wirkung erzeugt. Ich hoffe, dass der darauffolgende Diskurs in der online-Version der VoNa diese unerwünschte und für eine korrekte demokratische Wahlentscheidung schädliche Wirkung korrigiert oder zumindest gemildert hat.
Nun ist auch der "Volketswiler" vom 1 März ist mit einer solchen Situation konfrontiert: mitten in einem Bericht auf der Titelseite über ein Missbrauchsopfer, welches anderen Missbrauchsopfern Unterstützung anbietet, wurde das Konterfei einer Kandidatin (Kantonsrat) in Buttonform platziert, wobei der Titel des Berichts und der Name sowie die Partei der Kandidatin durch Fettdruck sogar noch hervorgehoben wurden (im Unterschied etwa zum Namen des Missbrauchsopfer in einer Bildlegende). Auch hier besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Leser zwischen der Kandidatin und dem Bericht einen (falschen) Zusammenhang sehen. Und auch hier gilt: vor allem wenn diese Assoziation im Unbewussten verharrt, kann sie eine unerwünschte Wirkung erzeugen. Ich hoffe, dass unsere Informationsmedien dieser Gefahr noch vermehrt ihre spezielle Achtsamkeit schenken.
Die vor Wahlen offiziell versandten Wahlunterlagen werden genutzt, um die Wähler über die sich zur Wahl stellenden Kandidaten zu informieren und diese zugleich mit einer Selbstdarstellung ihrer Partei sowie ihrer eigenen persönlichen Einschätzung zu präsentieren, dies durchaus auch in der legitimen Absicht, für die Partei und den Kandidaten politische Vorteile zu schaffen.
Die von den Parteien und Kandidaten präsentierten Ziele sind aus Sicht der Wähler eher Absichtserklärungen, soweit sie nicht durch Erfahrungen aus früheren politischen Aktivitäten der Partei resp. des betroffenen Kandidaten bestätigt werden. Nur eine einzige Partei hat mit der Eigenwerbung auch Synergie genutzt und ihren Unterlagen mit einer konkrete politischen Aktivität verbunden, indem für ihre Volksinitiative "Mehr Geld für Familien" ein Unterschriftsformular beigelegt wurde (Synergie-Nutzung halte ich für sinnvoll, zu dieser Initiative selber werde ich mich separat äussern).
Soweit der Wähler diesen Absichtserklärungen vertraut und die genannten Ziele befürwortet oder ablehnt, wird er dementsprechend seinen Wahlzettel hoffentlich ausfüllen - Wahlverweigerung wegen mangelndem Vertrauen in die deklarierten Absichten sind eine schlechte Alternative, weil sie den Einfluss der Bürgerentscheidung schwächen und verfälschen. Eigentlich ist die Bürgerentscheidung ein demokratisches Recht, das auch dann nicht zur Disposition steht, wenn der Bürger durch Verweigerung dieses demokratische Recht selber schwächt. Und eigentlich müssten Politiker in Parlamenten und Regierungen interessiert sein an guten und von einer möglichst breiten Basis der Bürger getroffenen und getragenen Entscheiden. Mir fällt jedoch auf, dass keine der Parteien sich explizit zu einer Stärkung der demokratischen Rechte des Bürgers bekennt oder eine Förderung der demokratischen Entscheidungsqualität im Hinblick auf den Nutzen für den individuellen Bürger und für die Gemeinschaft avisiert, geschweige denn dafür Ziele und Konzept-Absichten präsentiert.
Positiv habe ich zur Kenntnis genommen, dass die meisten Parteien für die Regierungsratswahl auch Kandidaten anderer Parteien über die Parteigrenzen hinweg ihren Wählern zur Wahl empfehlen. Dass dabei auch Eigeninteressen verfolgt werden (Gewinnung von Allianzen-Stimmen für die eigenen Kandidaten), halte ich für legitim, weil der Nutzen einer einvernehmlicheren Ausübung der Regierungsfunktion sowie der Wertschätzung von Kandidaten konkurrierender Parteien wichtiger ist als eine mögliche zusätzliche "Präsenz-Stärkung" von Parteien in der Regierung entgegen ihrer generellen Akzeptanz/Unterstützung durch das Volk.
Ich habe mich immer wieder für ein solches Allianzdenken auch bei Sachentscheiden ausgesprochen, und ich hoffe, dass auch die Parteien die Vorteile einer solchen Strategie (für die Parteien selber und vor allem für die Bevölkerung) auch bei Sachabstimmungen erkennen und nutzen - auch wenn davon in den aktuellen Unterlagen (noch) nichts zu lesen war.
Werner Klee; Kindhausen
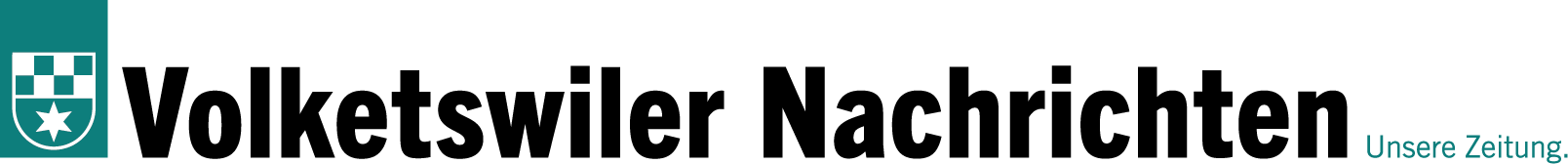

Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!