Eltern haben mit dem Kinderkriegen grundsätzlich auch die Verantwortung für Erziehung und Grundbildung. Es kann ja nicht sein, dass immer mehr Kinder – auch wenn sie meines Erachtens ein Jahr zu früh in den Kindergarten geschickt werden - die Farben nicht kennen, keine Schere halten, geschweige denn schneiden können und kein Wort Deutsch verstehen oder sprechen. Soziale und deutschsprachliche Erfahrungen gehören in erster Linie ins Elternhaus. Wie kommt der Steuerzahler dazu, diese Versäumnisse zu berappen? Und das seit Jahren zunehmend.
Sprachkompetenz als "must" für Einreisende
Die Kinder sind nicht schuld daran und können ja nichts dafür, wenn ihre Eltern sich weigern, selbst und mit ihnen zusammen Deutsch zu lernen. Sie sind aber ohne gute Deutschkenntnisse die Leidtragenden während ihrer gesamten Schulzeit und auch später. Kinder, die nichts oder nur wenig verstehen, zeigen sehr oft aggressive, lustlose, desinteressierte oder introvertierte Verhaltensmuster. Missverständnisse erzeugen Ängste und Unsicherheiten, schwächen das Selbstbewusstsein und machen mutlos. Man beobachte doch mal ein Kind, das gestern aus Südamerika anreiste und heute in der Klasse mit 24 anderen Kindern sitzt, aber kein Wort versteht. Das ist Schulalltag. Aufschreie der Lehrpersonen verschwinden meistens in den Schubladen der Bürokratie oder in den leeren Kassen. Viele Kinder scheitern durch ihre fehlende Sprachkompetenz an ihren möglichen Berufsaussichten, obwohl sie das Potential zu Höherem hätten. Wann endlich wird Deutsch als Voraussetzung für den Schuleintritt gefordert? In Basel müssen Dreijährigen, die kein Deutsch sprechen, an mindestens drei Halbtagen obligatorisch in eine Kita oder Spielgruppe. In der Stadt Zürich sprechen 18 Prozent der Kinder vor dem Kindergarten kein Deutsch. 40 Prozent sprechen Deutsch als Zweitsprache. Die Zahlen entsprechen in etwa unserer Gemeinde.
Mutige Politiker sind gefragt
Es ist schon lange an der Zeit, dass die Politik endlich den Mut aufbringt, Klartext zu reden und allgemein gültige Kriterien für den Eintritt in den Kindergarten zu fordern. Schule ist nun mal kein Kinderhütedienst oder Selbstbedienungsladen, in dem man sich nur das nimmt, wozu man gerade Lust hat, was mühelos zu erhalten ist und Spass macht. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage, die halt endlich einmal angepackt werden muss. Das Basler-Modell wurde 2019 vom Kantonsrat zwar knapp angenommen, ist bis anhin aber – wen erstaunt’s? – hängig. Vor allem in den Schulen mit hohem Migrantenanteil ist es schon länger nicht mehr möglich, den Lehrplan auch nur annähernd zu erfüllen, weil vielfach die nötigen Deutschkenntnisse fehlen. Hervorragende Lehrmittel für Rechtschreibung und Grammatik scheitern daran, dass Arbeitsanweisungen nicht verstanden werden oder schlicht das Interesse am Lernen fehlt. Ein Viertel aller Sechstklässler kann nicht verstehen, was gelesen wird. Eigene Texte halbwegs fehlerfrei zu schreiben ist für zu viele ein unüberwindbares Hindernis. Ist das die viel gepriesene, hohe Zürcher Schulqualität? Was passiert mit den Begabten und Lernfreudigen? Sie verlieren viel Lernzeit. Die neu eingerichteten Begabtenförderungsangebote sind ein lobender Ansatz, reichen aber nicht, um den deutschsprechenden und lernwilligen Kindern ein gutes effektives Lernen zu ermöglichen. Ein Tropfen auf dem heissen Stein. Um eine sinnvolle Differenzierung der Sprachfähigkeit im Schulzimmer zu ermöglichen, sind die Klassen um die Hälfte zu gross. Dazu kommen die Kinder mit Sondermassnahmenbedarf, die nicht gerade zu einer ruhigen, erfolgsbringenden Arbeitsumgebung beitragen. Es müssen also dringend Klein- und Deutschklassen her. Privatschulen arbeiten mit 12 bis 14 Kindern. Kein Wunder, dass in gewissen Gemeinde bald jedes fünfte Kind privat geschult wird.
Wie weiter?
Wie lange will die Politik noch zusehen und weiterhin in die öffentliche Tasche greifen, anstatt endlich ein Deutsch-Obligatorium für Eltern und deren Kinder einzuführe?. Die nunmehr so sehr erstarkte Einheitsgemeinde wird das ja wohl hinkriegen, zum Vorteil der Schulqualität, der Steuerlast und der Finanzlage. Es braucht von den Gemeinden – ich gebe zu, das könnte ein Vorteil der Einheitsgemeinde sein - viel mehr Druck auf den kantonalen zahnlosen Bürokratietiger, damit die Bildungsdirektorin Silvia Steiner endlich erwacht und tätig wird. Die Politik sollte sich an den nordischen Staaten orientieren, die genügend gute Beispiele liefern.
Vroni Harzenmoser
(Die Autorin ist ehemalige, langjährige Lehrkraft an der Schule Volketswil und interessiert sich auch heute noch für schulische Themen)
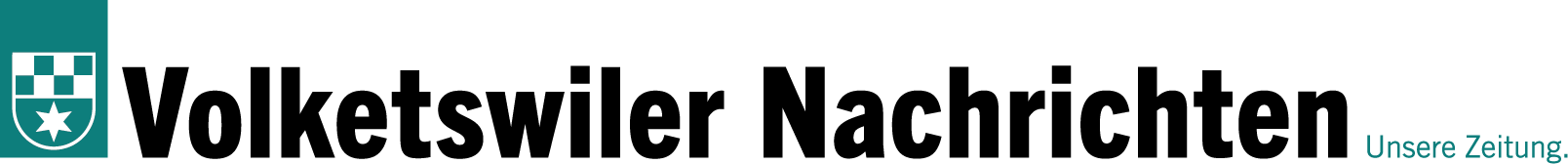

Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!